Von guten Gewohnheiten
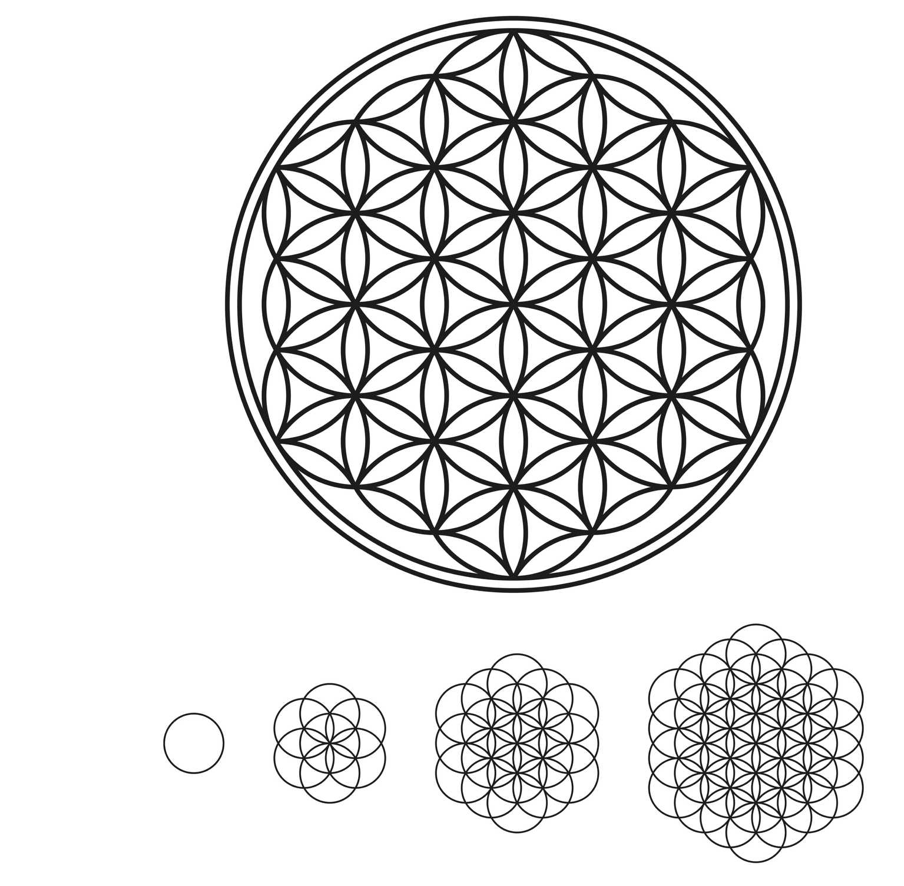
In der Krise kommt vieles zusammen, und es braucht Verschiedenes, um mit ihr umzugehen, sie zu bewältigen, zu durchleben und wieder aus ihr herauszutreten. Ein bewährtes Mittel sind Routinen, die uns guttun und stärken. (Das andere ist gleichzeitig auch im Raum: Welche Unterbrechung von Gewohnheiten und Routinen braucht es, um die Krise zu bewältigen?).
Routinen als Halt in Krisenzeiten
Solche guten Gewohnheiten können sich auf einen Tag beziehen, auf die Übergänge zwischen Tag und Nacht oder auf die Gestaltung eines Jahreszyklus und natürlich auch auf die großen Lebensereignisse wie Geburt, Krankheit und Tod, Erwachsenwerden, Lebensmitte, letzte Berufsjahre und Alter.
Je nach Persönlichkeit und Ausrichtung können ganz unterschiedliche Dinge solche Gewohnheiten sein, die in diesen Übergängen, die ja immer krisenhaft sind, oder in diesen Krisen, die ja immer auch Übergänge sind, stärkend wirken; ich denke da zum Beispiel an:
- den Gang in den Wald oder den Park
- das regelmäßige Sportprogramm oder die Alltagsbewegung (Treppen, Fahrrad, Laufen)
- Achtsamkeitsübungen wie beispielsweise ein dankbarer Tagesrückblick
- das wöchentliche Treffen oder Kochen/Essen mit guten Freunden oder Familie
- eine eigene kontemplative, meditative Praxis
- … und vieles andere mehr!
Warum Routinen wichtig sind
Aber warum sind solche Routinen oder „stilisierte, wiederholbare Handlungen an den typischen Übergängen und Brüchen des Lebens“ (Karl Gabriel) überhaupt wichtig? Routinen – in diesem Sinne verstanden – vollziehen etwas, was uns „im Rhythmus“ hält, was dem Rhythmus des/unseres Lebens angemessen ist.
Beschreibe ich es in eigenen Erfahrungen, dann haben solche Routinen auf mich u. a. folgende Wirkungen:
- sie schließen eine Tür und öffnen eine andere
- sie schaffen eine „andere (oder auch heilige) Zeit“
- sie sind eine Unterbrechung des nicht unterbrechenden Stroms der Ereignisse im Außen
- sie sind ein Raum der Zuwendung zu und Begegnung mit sich selbst, seinem Körper und/oder anderen
Selbstwirksamkeit durch Gewohnheiten
Gute Routinen bieten Halt im Umgang mit zum Beispiel Verletzbarkeit/Verletzlichkeit, Ungewissheit oder Ohnmacht – Phänomene, die uns in Schwellen- oder Krisensituationen ganz unwillkürlich begegnen.
Durch gute Gewohnheiten wird das Verletzte nicht geheilt, das Ungewisse nicht sicherer, aber in der Routine betrete ich meinen Gestaltungsraum und erlebe mich als selbstwirksam. Wie ich den Dingen begegnen will, woran ich festhalte und wie ich mich ausrichte, das liegt in meiner Gestaltungsmacht.
Wie neue Gewohnheiten entstehen
Es stellt sich die Frage, wie solche Gewohnheiten entstehen, wie man sie etablieren kann.
Aus der Gehirnforschung wissen wir, dass geübte Pfade für das Gehirn der beste Weg sind, effizient einen Auftrag zu erfüllen. Das Gehirn tickt wie folgt: „Habe ich schonmal gemacht. Hat schonmal funktioniert. Mache ich weiter so.“
Genau diese Stärke eines Pfades ist die Herausforderung, wenn es darum geht, einen neuen zu etablieren. Unser Gehirn sagt: „Wieso soll ich einen neuen Trampelpfad gehen, wenn der bekannte, gut ausgetretene Weg schon da ist? Ich bin nicht davon überzeugt, dass es sich lohnt, etwas Neues auszuprobieren. Zu viel Aufwand. Komm, wir nehmen den bekannten Weg.“
Gewohnheiten sind starke Vernetzungen im Gehirn und im Körper. Diese zu verändern, ist nicht einfach. Es geht also nicht nur darum, wie ich neue Gewohnheiten etabliere, sondern auch darum, wie ich alte Gewohnheiten verlerne bzw. innere Vernetzungen neu konfiguriere.
Elemente, die beim Etablieren helfen
Wenn ich an die Etablierung meiner eigenen Meditationsroutine denke, kommen mir folgende Elemente in Erinnerung, die mich darin unterstützt haben, sie zu finden, zu formen und zu halten.
1. Es braucht Zeit
In der Literatur finden sich unterschiedliche Zeitangaben, zwischen 30 und 90 Tagen ist ein Orientierungszeitraum. Allen Untersuchungen ist gemein: Es braucht schon eine Weile und geht nicht von heute auf morgen.
2. Es ist ein Willensakt
Auf dem Weg der Etablierung einer neuen Routine melden sich Stimmen, die sagen: „Och, heute aussetzen macht auch keinen Unterschied“. Oder auch: „Macht das überhaupt Sinn? Überleg doch nochmal neu.“
Ich habe für mich den Satz kultiviert: „Kraft meines Willens entscheide ich mich auch heute wieder, zu meditieren.“ Selbst wenn viele Stimmen das immer mal wieder boykottieren.
3. Es sind die vielen kleinen Schritte im eigenen Maß
Wenn ich mir vornehme, lange zu meditieren, und mich damit überfordere, dann verlässt mich schneller der Mut, als wenn ich mir vornehme: Jetzt 10 Minuten täglich, später dann 15 Minuten…
Was ist „mein Maß“, welchen Schritt kann ich jeden Tag oder jede Woche „gut gehen“, ohne mich zu überfordern?
4. Es sind die beständigen Wiederholungen
Als Faustregel gilt: Je häufiger ich etwas übe und wiederhole, desto stärker bilden sich die neuen Verknüpfungen, desto beständiger wird die neue Gewohnheit, die ich gerade dabei bin zu etablieren.
Lieber jeden Tag (oder wie der Rhythmus auch ist, den man sich wählt) 10 Minuten meditieren, als zweimal die Woche 35 Minuten.
Vier Grundhaltungen für tragfähige Routinen
Für mich habe ich auch noch vier Grundhaltungen, um mir wesentliche Routinen zu pflegen:
- Frage nicht, behaupte. Damit meine ich: Ich stelle nicht in Frage, dass es jetzt sinnvoll ist, zu meditieren, sondern ich stelle es für mich fest: Es macht Sinn.
- Nimm es an. Damit meine ich: Ob es gerade schwer ist oder leicht, ob es mir gerade entgegenkommt oder errungen werden muss, ich nehme es an.
- Bleib dabei. Damit meine ich: Vielleicht denke ich, ich brauche die regelmäßige Praxis gerade nicht, läuft doch alles. – Nein. Treu und beharrlich dabeibleiben, bei Regen und bei Sonnenschein.
- Mach was draus. Die gute Gewohnheit soll für mich kein Selbstzweck sein, keine Selbstverkrümmung, keine Selbstoptimierung. Für mich steht sie in Verbindung zu dem, was im Außen an Aufgaben auf mich wartet.
Meditation und Sport
Meditieren ist bei mir (fast) wie Zähneputzen geworden. Ich erlebe es als großes Geschenk, dass es mich auch in Zeiten trägt, die mich (manchmal auch über die Maßen) herausfordern.
Wenn ich an meine Sportroutine denke, da bin ich noch am Suchen, mein Maß zu finden, so dass es zu mir und meinen Möglichkeiten passt.
Routinen im Arbeitsalltag
Zum Abschluss möchte ich den Bogen zu unserer Arbeit im IPOS und in Beratungen schlagen. Dort haben wir zum Beispiel die Routine des „Check-in“ und „Check-out“ etabliert: Jede:r sagt kurz, wie er oder sie da ist und was geteilt werden will – zum Start und zum Ende eines Meetings. Manchmal mit einer konkreten Frage, manchmal ganz offen. Auch in Beratungen nutze ich dieses Element regelmäßig, weil es Rahmen und Halt gibt für das, was zwischen Check-In und Check-Out geschieht, sich inszeniert und bewegt wird. Ich möchte diese Routine nicht mehr missen.
Gute Gewohnheiten als Freiraum
Gute Gewohnheiten strukturieren ein Arbeitstreffen, den Tag, die Woche oder das Jahr. Sie ermöglichen es, die eigene Selbstwirksamkeit als Person oder Team zu kultivieren. Es geht bei guten Gewohnheiten nicht um ein Leistungsdenken, das auch noch „schaffen“ zu müssen, sondern genau um das Gegenteil: Die Unterbrechung von den An- und auch Überforderungen für sich bewusst zu inszenieren. Gute Gewohnheiten können einen Freiraum gewähren, über den niemand und nichts verfügen kann.
Schätzen Sie Ihre lieb gewonnenen Routinen wert und bleiben Sie ihnen treu! Schätzen Sie sich selbst und das Leben wert, indem Sie gute Gewohnheiten kultivieren!


